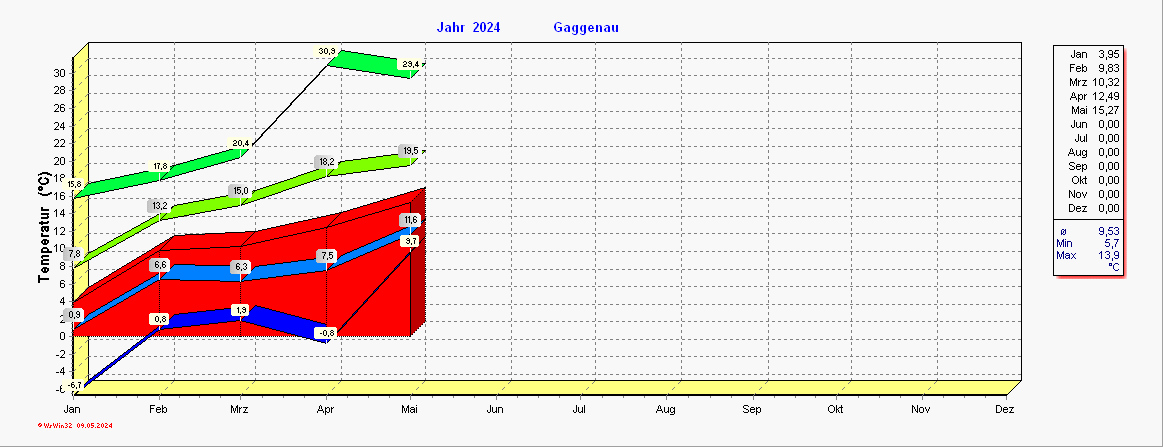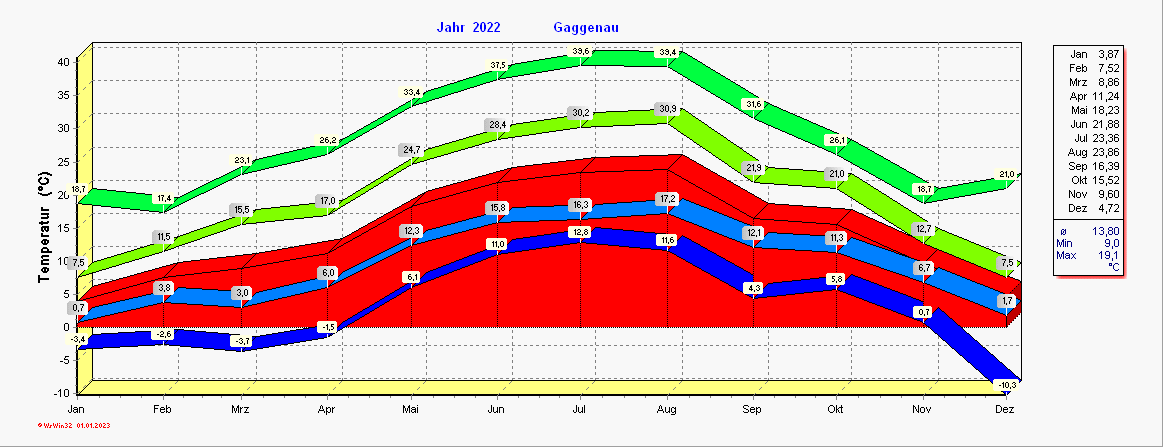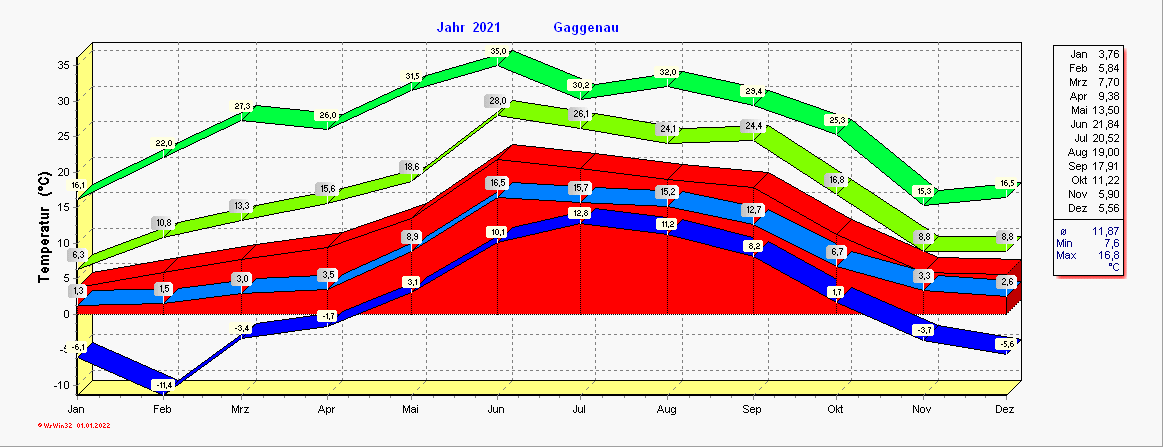Monatsberichte, Presseberichte und NEWS rund um die Wetterstation
Hier findet Ihr die Wetterrückblicke von 2021 bis 2023 sowie News rund um die Wetterstation......
Die Wetterrückblicke werden im fünf Jahresrythmus festgehalten.
Die Wetterrückblicke werden im fünf Jahresrythmus festgehalten.
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
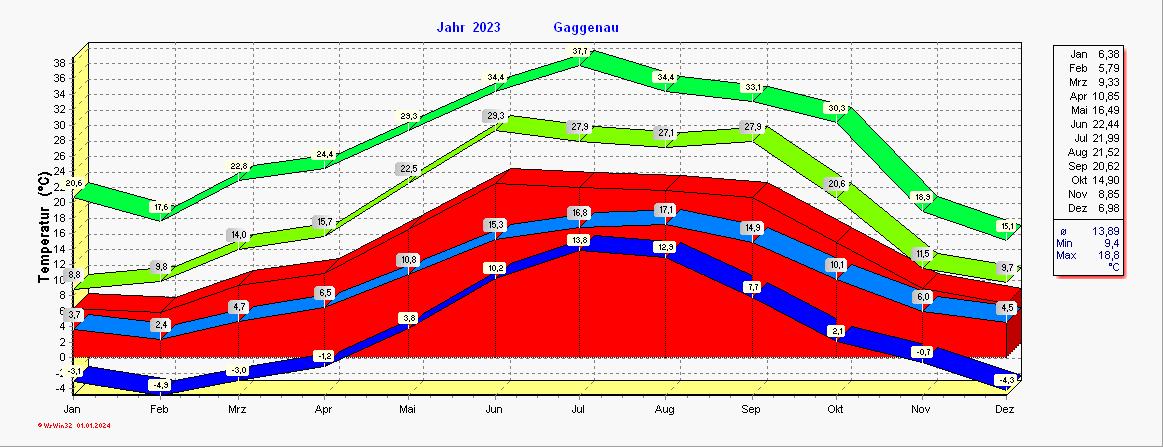
-
Jan
-
Feb
-
Mär
-
Apr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Aug
-
Sep
-
Okt
-
Nov
-
Dez
-
Jahresrückblick
Wetterrückblick Januar Zu trüb, zu warm und mit viel Regen
Von Dieter Kraft und Thomas Senger
Murgtal – Der erste Monat des Jahres 2023 – nicht nur im Murgtal bleibt er wegen dreier Wettererscheinungen in Erinnerung: Sonnenscheinarmut, relativ hohe Temperaturen zu Beginn und ausgiebigen Niederschläge zur Monatsmitte hin. Auch der Januar 2023 reiht sich in die zu warmen Januarmonate ein: Laut Deutschem Wetterdienst zählt er zu den zehn wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881.
Ein trüber Monat: Nur 34,8 Sonnenscheinstunden wurden an der Wetterstation von Dieter Kraft in Ottenau aufgezeichnet. An manchen Tagen, insbesondere in der letzten Dekade, waren es „nullkommanull“. Daher kann man gut und gerne von einem trüben und deutlich zu warmen Januar schreiben.
Hohe Temperaturen: 20,6 ° Celsius registrierte Dieter Kraft in Ottenau als Temperaturmaximum für den Neujahrstag. Das war also fast genauso viel wie an Silvester, als das Quecksilber auf 21 ° C kletterte. Am zweiten Januar wurden noch 19,4 °C aufgezeichnet.
Wie kam es dazu? Der Meteorologe Andreas Fink weiß Bescheid. Er ist Professor am KIT Institute of Meteorology and Climate Research. Er erinnert an das Tauwetter, das bereits zu Weihnachten durch südwestliche Strömung eintrat. Sehr warme und teilweise feuchte Luft wehte heran. „Durch die Stauwirkung an der Westabdachung des Schwarzwaldes ist insbesondere am Grindenkamm viel Niederschlag gefallen“, berichtet Fink. Die extreme Wärme von Ende Dezember hielt auch in den ersten Januartagen an. Diese Wetterlage hatte schon in der zweiten Dezemberhälfte zu einem Gesamtniederschlag im Dezember von 211 Millimetern am Ruhestein geführt. Andreas Fink: „Das ist Wetter, Zufall, Chaos.“ Zu bedenken sei dabei, dass in jenen Tagen die Wasser-Temperatur in der Biskaya, dem Herkunftsgebiet der Luftströmung, schon ein, zwei Grad Celsius höher war als normal. „Dies hat zu den extremen Temperatur-Maxima mit beigetragen“, erklärt der Meteorologe.
Hohe Niederschlagsmenge: Erst in der zweiten Januarhälfte kam es mit nordwestlicher Strömung zu Schneefällen. Zuvor allerdings gab es einige Tage mit ergiebigem Regen. Je nach Bodenbeschaffenheit konnte mancherorts in dem gesättigten Oberboden das Wasser nicht mehr versickern.
Wie kam es dazu? Professor Fink kennt den einfachen physikalischen Hintergrund für diese höhere Niederschlagsmenge: Es liegt an der warmen Luft. Diese kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft. Wenn die warme Luft aus Südwest aber aufsteigt, zum Beispiel an den Westhängen des Schwarzwalds, dann kühlt sie sich ab. In der Folge fällt der Wasserdampf als Regen aus. Je wärmer und damit feuchter die Ursprungsluft, umso mehr Niederschlag. Zwar ist dieses Prinzip auch bei kalter Luft und damit bei Schneefall gültig. Doch grundsätzlich ist dabei die Wassermenge geringer – weil kalte Luft eben weniger Wasserdampf enthält als warme Luft. Die ersten beiden Dekaden waren sehr niederschlagsreich, die Gesamtniederschlagsmenge im Januar wurde mit 92,6 l/m2 (Normalsoll 75 l/m2) aufgezeichnet. Gleichwohl: Der Januar 2022 war in der ersten Dekade noch deutlich feuchter mit sogar 102,4 l/m2.
Ist eine Tendenz zu ergiebigen Regenfällen im Januar erkennbar? Ein Hobby-Meteorologe, der sich mit dieser Frage befasst, ist Wolfgang Roos aus Herrenberg. Er analysiert regelmäßig unter anderem Messwerte im Nordschwarzwald. „Wenn es bei Westwetterlagen ein oder zwei Grad zu warm ist, dann steigt die Schneegrenze entsprechend um etwa hundert, zweihundert Meter“, weiß er aus Erfahrung. In der langjährigen Bilanz, über drei Jahrzehnte hinweg, sei eine ganz leichte Erhöhung der winterlichen Niederschlagssummen statistisch nachvollziehbar: So ist laut Roos die durchschnittliche Niederschlagssumme der Jahre 1991 bis 2020 um rund fünf Prozent höher als in den Jahren 1981 bis 2010.
Ob man daraus bereits eine Tendenz hin zu einem subtropischen Klima mit einem Regenmaximum im Winter ableiten kann? Roos ist zurückhaltend. Eine Tendenz zu subtropischem Klima in unseren Breiten ließe sich eher mit Blick auf Frühjahr und Sommer ableiten: Diese tendieren dazu, trockener und heißer zu werden – so wie man sie am Mittelmeer kennt.
Der Januar im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer):
Temperaturdurchschnitt 6,4 °C (3,9 °C), Niederschlag 92,6 l/m2 (117,4 l/m2), Niederschlagstage 19 (17)
Murgtal – Der erste Monat des Jahres 2023 – nicht nur im Murgtal bleibt er wegen dreier Wettererscheinungen in Erinnerung: Sonnenscheinarmut, relativ hohe Temperaturen zu Beginn und ausgiebigen Niederschläge zur Monatsmitte hin. Auch der Januar 2023 reiht sich in die zu warmen Januarmonate ein: Laut Deutschem Wetterdienst zählt er zu den zehn wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881.
Ein trüber Monat: Nur 34,8 Sonnenscheinstunden wurden an der Wetterstation von Dieter Kraft in Ottenau aufgezeichnet. An manchen Tagen, insbesondere in der letzten Dekade, waren es „nullkommanull“. Daher kann man gut und gerne von einem trüben und deutlich zu warmen Januar schreiben.
Hohe Temperaturen: 20,6 ° Celsius registrierte Dieter Kraft in Ottenau als Temperaturmaximum für den Neujahrstag. Das war also fast genauso viel wie an Silvester, als das Quecksilber auf 21 ° C kletterte. Am zweiten Januar wurden noch 19,4 °C aufgezeichnet.
Wie kam es dazu? Der Meteorologe Andreas Fink weiß Bescheid. Er ist Professor am KIT Institute of Meteorology and Climate Research. Er erinnert an das Tauwetter, das bereits zu Weihnachten durch südwestliche Strömung eintrat. Sehr warme und teilweise feuchte Luft wehte heran. „Durch die Stauwirkung an der Westabdachung des Schwarzwaldes ist insbesondere am Grindenkamm viel Niederschlag gefallen“, berichtet Fink. Die extreme Wärme von Ende Dezember hielt auch in den ersten Januartagen an. Diese Wetterlage hatte schon in der zweiten Dezemberhälfte zu einem Gesamtniederschlag im Dezember von 211 Millimetern am Ruhestein geführt. Andreas Fink: „Das ist Wetter, Zufall, Chaos.“ Zu bedenken sei dabei, dass in jenen Tagen die Wasser-Temperatur in der Biskaya, dem Herkunftsgebiet der Luftströmung, schon ein, zwei Grad Celsius höher war als normal. „Dies hat zu den extremen Temperatur-Maxima mit beigetragen“, erklärt der Meteorologe.
Hohe Niederschlagsmenge: Erst in der zweiten Januarhälfte kam es mit nordwestlicher Strömung zu Schneefällen. Zuvor allerdings gab es einige Tage mit ergiebigem Regen. Je nach Bodenbeschaffenheit konnte mancherorts in dem gesättigten Oberboden das Wasser nicht mehr versickern.
Wie kam es dazu? Professor Fink kennt den einfachen physikalischen Hintergrund für diese höhere Niederschlagsmenge: Es liegt an der warmen Luft. Diese kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft. Wenn die warme Luft aus Südwest aber aufsteigt, zum Beispiel an den Westhängen des Schwarzwalds, dann kühlt sie sich ab. In der Folge fällt der Wasserdampf als Regen aus. Je wärmer und damit feuchter die Ursprungsluft, umso mehr Niederschlag. Zwar ist dieses Prinzip auch bei kalter Luft und damit bei Schneefall gültig. Doch grundsätzlich ist dabei die Wassermenge geringer – weil kalte Luft eben weniger Wasserdampf enthält als warme Luft. Die ersten beiden Dekaden waren sehr niederschlagsreich, die Gesamtniederschlagsmenge im Januar wurde mit 92,6 l/m2 (Normalsoll 75 l/m2) aufgezeichnet. Gleichwohl: Der Januar 2022 war in der ersten Dekade noch deutlich feuchter mit sogar 102,4 l/m2.
Ist eine Tendenz zu ergiebigen Regenfällen im Januar erkennbar? Ein Hobby-Meteorologe, der sich mit dieser Frage befasst, ist Wolfgang Roos aus Herrenberg. Er analysiert regelmäßig unter anderem Messwerte im Nordschwarzwald. „Wenn es bei Westwetterlagen ein oder zwei Grad zu warm ist, dann steigt die Schneegrenze entsprechend um etwa hundert, zweihundert Meter“, weiß er aus Erfahrung. In der langjährigen Bilanz, über drei Jahrzehnte hinweg, sei eine ganz leichte Erhöhung der winterlichen Niederschlagssummen statistisch nachvollziehbar: So ist laut Roos die durchschnittliche Niederschlagssumme der Jahre 1991 bis 2020 um rund fünf Prozent höher als in den Jahren 1981 bis 2010.
Ob man daraus bereits eine Tendenz hin zu einem subtropischen Klima mit einem Regenmaximum im Winter ableiten kann? Roos ist zurückhaltend. Eine Tendenz zu subtropischem Klima in unseren Breiten ließe sich eher mit Blick auf Frühjahr und Sommer ableiten: Diese tendieren dazu, trockener und heißer zu werden – so wie man sie am Mittelmeer kennt.
Der Januar im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer):
Temperaturdurchschnitt 6,4 °C (3,9 °C), Niederschlag 92,6 l/m2 (117,4 l/m2), Niederschlagstage 19 (17)
Wetterrueckblick Februar, Mild in den Niederungen, winterlich nur in den Hochlagen
Von Dieter Kraft und Thomas Senger
Murgtal – Mild in den Niederungen, winterlich nur in den Hochlagen: Der Februar präsentierte sich auch im Murgtal relativ warm. Gleichwohl war nicht selten ein Phänomen zu beobachten, das als Frostwechsel bekannt ist: Temperaturen über dem Gefrierpunkt tagsüber – und zumeist in den Nächten das Unterschreiten der Null-Grad-Marke. Dies beansprucht Bauwerke in besonderem Maße.
Der Monat im Überblick: Auch der letzte Wintermonat war mal wieder zu warm und entsprach dem Trend der vergangenen Monate. Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation Ottenau lag bei 5,8°C. Immerhin war er damit kälter als der Februar 2022. Anfänglich war es noch recht winterlich und kühl, der Minimalwert wurde am 8. (8. Februar, 0 Uhr) mit - 4,9 °C aufgezeichnet. Der Maximalwert wurde am 21. Februar (15.35 Uhr) mit frühlingshaften 17,6 °C gemessen. Der Gesamtniederschlag wurde mit dürftigen 24,6 l/m2 an elf Tagen aufgezeichnet, also gerade mal ein gutes Drittel des Normalsolls von 68 l/m2. Die Summe von 102,8 Sonnenscheinstunden dagegen kann sich sehen lassen.
Frostwechsel: Tagsüber warm, nachts kalt: KIT-Wissenschaftlerin Vanessa Mercedes Kind befasst sich mit Frostwechseltagen – und vor allem mit deren Auswirkungen auf Beton. Für die Expertin vom Institut für Massivbau und Baustofftechnologie ist der „Frostangriff“ Alltagsgeschäft: „Mein Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, mit dem man vorhersagen kann, wie sich Betonbauwerke unter Frost verändern“, berichtet sie.
Denn die Volumenausdehnung von Wasser beim Gefrieren ist die Hauptursache für Frostschäden: Schließlich erfährt Wasser während des Unterschreitens des Gefrierpunkts eine Volumenzunahme von neun Prozent – beim Übergang vom wasserförmigen in den festen Aggregatszustand. Diese Sprengwirkung lässt sich an Bauwerken, Felswänden oder Straßenbelägen erkennen.
Feuchtigkeit war auch in diesem Februar vorhanden. Wie die Grafik zeigt, hatte es in den ersten fünf Tagen Niederschlag gegeben, der in Ritzen und Spalten sickern konnte. Die Tage danach bildeten eine nahezu durchgängige Frostwechselperiode.
In der Standard-Messhöhe zwei Meter über Geländeoberfläche registrierte die Station in Ottenau im Februar insgesamt zwölf Tage mit Frostwechsel; fünf Zentimeter über dem Boden waren es 13 Tage; direkt an der Geländeoberfläche dürften es sogar knapp 20 Frostwechseltage gewesen sein.
Bei einer tendenziellen Klimaerwärmung kommt es öfter zu Frostwechseltagen, denn Tage mit Dauerfrost werden weniger. Darunter kann der Beton leiden. Die Herstellung des Baustoffs selbst wiederum ist ein maßgeblicher Emittent von CO2. Dieses Gas ist wegen seiner „Treibhauseigenschaften“ maßgebliche Voraussetzung für Leben auf der Erde – es gilt aber auch als wesentliche Ursache für eine derzeit messbare Klimaerwärmung. So gesehen könnte die Herstellung von Beton also indirekt die „Überlebenschancen“ des Baustoffs auch verschlechtern.
Hier setzt die KIT-Forscherin an: Neue Zemente und alternative Bindemittel enthalten weniger gebrannten Kalkstein, es wird also bei deren Herstellung weniger CO2 emittiert.
Allerdings ändern sich so die Eigenschaften des Betons – unter anderem die Frostbeständigkeit. Vanessa Mercedes Kind: „Daher benötigen wir Modelle, die zeigen, wie sich diese Frostschädigung in Abhängigkeit der Zusammensetzung des Betons, seines Alters und der Witterungsbedingungen verändert.“
Das Forschungsfeld ist komplex: So ist der Gefrierpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig: Porenstruktur beispielsweise oder chemische Zusammensetzung des Wassers. Bei kleinen Betonporen wirken zum Beispiel sehr große Oberflächenkräfte auf das Wasser. Dadurch wird der Gefrierpunkt gesenkt.
Mercedes Kind: „Das bedeutet, es gefriert nicht alles Wasser auf einmal bei 0 °C, sondern bei unterschiedlichen Temperaturen.“
Der Februar im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer):
Temperaturdurchschnitt 5,8°C (7,5°C), Niederschlag 24,6 l/m2 (85,4 l/m2), Niederschlagstage 11 (17).
Murgtal – Mild in den Niederungen, winterlich nur in den Hochlagen: Der Februar präsentierte sich auch im Murgtal relativ warm. Gleichwohl war nicht selten ein Phänomen zu beobachten, das als Frostwechsel bekannt ist: Temperaturen über dem Gefrierpunkt tagsüber – und zumeist in den Nächten das Unterschreiten der Null-Grad-Marke. Dies beansprucht Bauwerke in besonderem Maße.
Der Monat im Überblick: Auch der letzte Wintermonat war mal wieder zu warm und entsprach dem Trend der vergangenen Monate. Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation Ottenau lag bei 5,8°C. Immerhin war er damit kälter als der Februar 2022. Anfänglich war es noch recht winterlich und kühl, der Minimalwert wurde am 8. (8. Februar, 0 Uhr) mit - 4,9 °C aufgezeichnet. Der Maximalwert wurde am 21. Februar (15.35 Uhr) mit frühlingshaften 17,6 °C gemessen. Der Gesamtniederschlag wurde mit dürftigen 24,6 l/m2 an elf Tagen aufgezeichnet, also gerade mal ein gutes Drittel des Normalsolls von 68 l/m2. Die Summe von 102,8 Sonnenscheinstunden dagegen kann sich sehen lassen.
Frostwechsel: Tagsüber warm, nachts kalt: KIT-Wissenschaftlerin Vanessa Mercedes Kind befasst sich mit Frostwechseltagen – und vor allem mit deren Auswirkungen auf Beton. Für die Expertin vom Institut für Massivbau und Baustofftechnologie ist der „Frostangriff“ Alltagsgeschäft: „Mein Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, mit dem man vorhersagen kann, wie sich Betonbauwerke unter Frost verändern“, berichtet sie.
Denn die Volumenausdehnung von Wasser beim Gefrieren ist die Hauptursache für Frostschäden: Schließlich erfährt Wasser während des Unterschreitens des Gefrierpunkts eine Volumenzunahme von neun Prozent – beim Übergang vom wasserförmigen in den festen Aggregatszustand. Diese Sprengwirkung lässt sich an Bauwerken, Felswänden oder Straßenbelägen erkennen.
Feuchtigkeit war auch in diesem Februar vorhanden. Wie die Grafik zeigt, hatte es in den ersten fünf Tagen Niederschlag gegeben, der in Ritzen und Spalten sickern konnte. Die Tage danach bildeten eine nahezu durchgängige Frostwechselperiode.
In der Standard-Messhöhe zwei Meter über Geländeoberfläche registrierte die Station in Ottenau im Februar insgesamt zwölf Tage mit Frostwechsel; fünf Zentimeter über dem Boden waren es 13 Tage; direkt an der Geländeoberfläche dürften es sogar knapp 20 Frostwechseltage gewesen sein.
Bei einer tendenziellen Klimaerwärmung kommt es öfter zu Frostwechseltagen, denn Tage mit Dauerfrost werden weniger. Darunter kann der Beton leiden. Die Herstellung des Baustoffs selbst wiederum ist ein maßgeblicher Emittent von CO2. Dieses Gas ist wegen seiner „Treibhauseigenschaften“ maßgebliche Voraussetzung für Leben auf der Erde – es gilt aber auch als wesentliche Ursache für eine derzeit messbare Klimaerwärmung. So gesehen könnte die Herstellung von Beton also indirekt die „Überlebenschancen“ des Baustoffs auch verschlechtern.
Hier setzt die KIT-Forscherin an: Neue Zemente und alternative Bindemittel enthalten weniger gebrannten Kalkstein, es wird also bei deren Herstellung weniger CO2 emittiert.
Allerdings ändern sich so die Eigenschaften des Betons – unter anderem die Frostbeständigkeit. Vanessa Mercedes Kind: „Daher benötigen wir Modelle, die zeigen, wie sich diese Frostschädigung in Abhängigkeit der Zusammensetzung des Betons, seines Alters und der Witterungsbedingungen verändert.“
Das Forschungsfeld ist komplex: So ist der Gefrierpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig: Porenstruktur beispielsweise oder chemische Zusammensetzung des Wassers. Bei kleinen Betonporen wirken zum Beispiel sehr große Oberflächenkräfte auf das Wasser. Dadurch wird der Gefrierpunkt gesenkt.
Mercedes Kind: „Das bedeutet, es gefriert nicht alles Wasser auf einmal bei 0 °C, sondern bei unterschiedlichen Temperaturen.“
Der Februar im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer):
Temperaturdurchschnitt 5,8°C (7,5°C), Niederschlag 24,6 l/m2 (85,4 l/m2), Niederschlagstage 11 (17).
Wetterrückblick der März im Murgtal – er war vor allem feucht:
Als am 8. März endlich wieder Regen fiel, ging damit im Murgtal eine mehr als vierwöchige Periode zu Ende, in der es nur an drei Tagen Niederschlag gab – und das in einer verschwindend geringen Gesamtsumme von sechseinhalb Litern pro Quadratmeter. Dann aber waren die Schleusen geöffnet: 166,8 l/m2 hat unsere Station in Ottenau gemessen. Das ist mehr als das Siebenfache der 23 l/m2 des Vorjahresmonats.
Die Temperaturwerte hüpften hin und her. Fünfmal gab es Temperaturen von 20 °C oder mehr. Der erste Frühlingsmonat war in Summe zu mild, aber dafür mit Abstand deutlich zu nass.
Temperaturen und Niederschlag: Sie sind entscheidend für das Vegetationswachstum. Dies bestätigt Andrea Ganter. Sie ist Leiterin des Landwirtschaftsamts im Landratsamt Rastatt. Gerade beim Niederschlag gab es einiges aufzuholen. Die Messwerte an der Station Ottenau bestätigen, dass die Bodenfeuchte sich durch die Niederschläge deutlich verbessert hat.
„Im vergangenen Sommer waren aufgrund der anhaltenden Trockenheit die Wiesen und Weiden völlig ausgetrocknet und die Tierhalter mussten auf ihre Wintervorräte zurückgreifen, um die Tiere entsprechend ernähren zu können“, berichtet Andrea Ganter. Doch nach den ersten Niederschlägen im September habe sich das Grünland erstaunlich schnell erholt, und aufgrund des ausreichenden Niederschlags und den milden Temperaturen weit in den Dezember hinein gab es nochmals einen sehr guten Aufwuchs an Gräsern und Kräutern.
Dies war in der Region durchaus zu beobachten: „Denn das Murgtal ist geprägt von extensiver Grünlandwirtschaft. Mutterkühe, Schafe und Ziegen weiden in den zum Teil schwer zugänglichen Lagen. Die Wiesen werden zur Futterwerbung genutzt.“
Eine lange Winterpause war für das Grünland nicht zu konstatieren. Und mittlerweile kommen Gräser und Kräuter je nach Höhenlage aus dem Winterschlaf, da bereits ab 5°C das Wachstum der Gräser wieder zunimmt.
„Der Vegetationsbeginn für das Grünland war nach der Meldung des Deutschen Wetterdienstes schon Anfang März in einigen Regionen erreicht, in den mittleren Lagen des Schwarzwaldes lag der Beginn um den 20. März“, berichtet Ganter.
Eine Möglichkeit, den Vegetationsbeginn statistisch zu erfassen, ist die Grünlandtemperatursumme. Dieses Temperatursummenmodell von Erns t & Loeper wird in der Agrarmeteorologie für die gemäßigten Klimaräume angewendet. Der Vegetationsbeginn für Grünland gilt als erreicht, wenn die Summe der Tagesmitteltemperaturen den Wert 200 erreicht.
Ganter: „Genutzt wird dieses Prognosemodell allerdings in Regionen mit intensiverem Grünlandanbau und vor allem im Ackerbau, um die Düngung zu optimieren. Das spielt im Murgtal weniger eine Rolle, da die Flächen oft wenig oder gar nicht und dann ausschließlich mit Festmist gedüngt werden. Gülle und Mineraldüngung spielen hier keine Rolle.“
Gleichwohl sei der Vegetationsbeginn ein guter Anhaltspunkt, um mit der Pflege des Grünlandes zu beginnen – vorausgesetzt, die Flächen sind abgetrocknet und befahrbar. Zurück zu den Niederschlägen: „Ein abschließendes Urteil wie gut sich das Grünland von der letztjährigen Trockenheit erholt hat oder ob es Veränderungen in der Zusammensetzung gab, wird sich zeigen, wenn die Bestände bis in ein paar Wochen voll entwickelt sind.“
Der März im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 9,3 °C (8,9 °C), Niederschlag 166,8 l/m2 (23 l/m2), Niederschlagstage 16 (5).
Die Temperaturwerte hüpften hin und her. Fünfmal gab es Temperaturen von 20 °C oder mehr. Der erste Frühlingsmonat war in Summe zu mild, aber dafür mit Abstand deutlich zu nass.
Temperaturen und Niederschlag: Sie sind entscheidend für das Vegetationswachstum. Dies bestätigt Andrea Ganter. Sie ist Leiterin des Landwirtschaftsamts im Landratsamt Rastatt. Gerade beim Niederschlag gab es einiges aufzuholen. Die Messwerte an der Station Ottenau bestätigen, dass die Bodenfeuchte sich durch die Niederschläge deutlich verbessert hat.
„Im vergangenen Sommer waren aufgrund der anhaltenden Trockenheit die Wiesen und Weiden völlig ausgetrocknet und die Tierhalter mussten auf ihre Wintervorräte zurückgreifen, um die Tiere entsprechend ernähren zu können“, berichtet Andrea Ganter. Doch nach den ersten Niederschlägen im September habe sich das Grünland erstaunlich schnell erholt, und aufgrund des ausreichenden Niederschlags und den milden Temperaturen weit in den Dezember hinein gab es nochmals einen sehr guten Aufwuchs an Gräsern und Kräutern.
Dies war in der Region durchaus zu beobachten: „Denn das Murgtal ist geprägt von extensiver Grünlandwirtschaft. Mutterkühe, Schafe und Ziegen weiden in den zum Teil schwer zugänglichen Lagen. Die Wiesen werden zur Futterwerbung genutzt.“
Eine lange Winterpause war für das Grünland nicht zu konstatieren. Und mittlerweile kommen Gräser und Kräuter je nach Höhenlage aus dem Winterschlaf, da bereits ab 5°C das Wachstum der Gräser wieder zunimmt.
„Der Vegetationsbeginn für das Grünland war nach der Meldung des Deutschen Wetterdienstes schon Anfang März in einigen Regionen erreicht, in den mittleren Lagen des Schwarzwaldes lag der Beginn um den 20. März“, berichtet Ganter.
Eine Möglichkeit, den Vegetationsbeginn statistisch zu erfassen, ist die Grünlandtemperatursumme. Dieses Temperatursummenmodell von Erns t & Loeper wird in der Agrarmeteorologie für die gemäßigten Klimaräume angewendet. Der Vegetationsbeginn für Grünland gilt als erreicht, wenn die Summe der Tagesmitteltemperaturen den Wert 200 erreicht.
Ganter: „Genutzt wird dieses Prognosemodell allerdings in Regionen mit intensiverem Grünlandanbau und vor allem im Ackerbau, um die Düngung zu optimieren. Das spielt im Murgtal weniger eine Rolle, da die Flächen oft wenig oder gar nicht und dann ausschließlich mit Festmist gedüngt werden. Gülle und Mineraldüngung spielen hier keine Rolle.“
Gleichwohl sei der Vegetationsbeginn ein guter Anhaltspunkt, um mit der Pflege des Grünlandes zu beginnen – vorausgesetzt, die Flächen sind abgetrocknet und befahrbar. Zurück zu den Niederschlägen: „Ein abschließendes Urteil wie gut sich das Grünland von der letztjährigen Trockenheit erholt hat oder ob es Veränderungen in der Zusammensetzung gab, wird sich zeigen, wenn die Bestände bis in ein paar Wochen voll entwickelt sind.“
Der März im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 9,3 °C (8,9 °C), Niederschlag 166,8 l/m2 (23 l/m2), Niederschlagstage 16 (5).
Wetterrückblick der April im Murgtal – Auf und nieder
Auf und nieder – und nur ganz selten wie im Frühling
Der April im Murgtal war ein typischer Vertreter seiner launischen Zunft
Murgtal – Er machte wohl wieder, was er scheinbar wollte: Der April im Murgtal erwies sich als Meister des Unbeständigen. Ein stetes Auf und Ab der Temperaturen; ein gefühlt recht kühler Monat mit sehr viel Regen. Aber kann man von einem klassischen typischen April reden?
Deutschlandweit betrachtet war dies der erste zu niederschlagsreiche April seit 15 Jahren (Quelle DWD). Dank dieser Niederschlägen erstarkte das Grün in einem Wachstumsschub: satte grüne Wiesen allenthalben.
Die Temperaturwerte fuhren mal wieder eine wilde Achterbahn, wie auch unsere Grafik zeigt. Die Werte an der Station Ottenau beinhalten nahezu alles: Von frühlingshaften ersten warmen Tagen bis zu Frost war alles vertreten. Niederschläge wurden an manchen Tagen von heftigen Gewittern und stürmischen Böen begleitet, örtlich wurden gar Hagelniederschläge gemeldet. Es war so, wie man es eben kennt: „April, April, der macht, was er will!“
Kann man wirklich von einem klassischen typischen April reden?
Tatsächlich war dieser April im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 – das ist eine wärmere Referenzperiode – um circa anderthalb Grad Celsius zu kalt.“
Wie kommt es zu dieser typischen „Launenhaftigkeit“ im April?
Wie immer gibt es für natürliche Erscheinungen keinen bösen oder guten Willen, sondern schlicht und ergreifend naturwissenschaftliche Grundlagen. Dies gilt auch für den oft raschen Wechsel der Wetterlagen: zum Beispiel vom typischen Aprilschauer, der früher auch mal Schnee bis ins Flachland brachte, hin zu strahlendem Sonnenschein-Wetter. Die Sonne spielt dabei eine entscheidende Rolle, gibt Professor Fink zu bedenken. Denn die Sonnenstrahlung ist im April wegen ihres relativ hohen Einstrahlwinkels schon sehr intensiv. Man bedenke: Der jahreszeitliche Tiefststand der Sonne Ende Dezember ist Anfang April schon ein Vierteljahr her. Die starke „Kraft“ der Sonne im April führt somit auch zu einer schnellen Erwärmung der Erdoberfläche, sobald sich Wolken verziehen. Dies begünstigt die bekannte „Wechselhaftigkeit“ – anders als im Januar, wenn die Sonne sehr tief steht und wenig „Kraft“ hat.
Welchen Einfluss haben die Großwetterlagen?
Die Wetterexperten verweisen auf das häufige Auftreten von „Kaltlufttropfen“ in höheren Luftschichten. Diese brachten beispielsweise in der dritten Dekade in Höhenlagen noch einmal Schneefälle.
Es gab relativ häufig Kaltluftvorstöße aus dem Norden, und dadurch das klassische Aprilwetter mit Schauern. Ungestörte Hochdrucklagen, die in den Vorjahren oft das Geschehen bestimmten und für „Schönwetter“ sorgten, waren nicht zu verzeichnen. Sie sind für den April auch eher untypisch.
Anders als in den vergangenen Jahren, als es schon Ende März/Anfang April sogenannte Sommertage gab, waren diese im April nicht zu verzeichnen. Ein „Sommertag“ im Sinne der Wetterkundler ist ein Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur 25,0 °C erreicht oder überschreitet. Als Maximaltemperatur wurden an der Station in Ottenau am 22. April 24,4 °C gemessen.
War der April reich an Niederschlägen?
Gut 112 Liter pro Quadratmeter fielen an der Station Ottenau im April. Zusammen mit dem Niederschlag aus dem März (167 Liter pro Quadratmeter) sind das knapp 280 Liter in diesen Frühjahrsmonaten.
Im April 2022 fielen sogar 125,6 l/m2 in Ottenau. Aber 2021 gingen lediglich 48,4 Liter darnieder,
Der April im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 10,9 °C (11,2 °C), Niederschlag 112,4 l/m2 (125,6 l/m2), Niederschlagstage 15 (13).
Der April im Murgtal war ein typischer Vertreter seiner launischen Zunft
Murgtal – Er machte wohl wieder, was er scheinbar wollte: Der April im Murgtal erwies sich als Meister des Unbeständigen. Ein stetes Auf und Ab der Temperaturen; ein gefühlt recht kühler Monat mit sehr viel Regen. Aber kann man von einem klassischen typischen April reden?
Deutschlandweit betrachtet war dies der erste zu niederschlagsreiche April seit 15 Jahren (Quelle DWD). Dank dieser Niederschlägen erstarkte das Grün in einem Wachstumsschub: satte grüne Wiesen allenthalben.
Die Temperaturwerte fuhren mal wieder eine wilde Achterbahn, wie auch unsere Grafik zeigt. Die Werte an der Station Ottenau beinhalten nahezu alles: Von frühlingshaften ersten warmen Tagen bis zu Frost war alles vertreten. Niederschläge wurden an manchen Tagen von heftigen Gewittern und stürmischen Böen begleitet, örtlich wurden gar Hagelniederschläge gemeldet. Es war so, wie man es eben kennt: „April, April, der macht, was er will!“
Kann man wirklich von einem klassischen typischen April reden?
Tatsächlich war dieser April im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 – das ist eine wärmere Referenzperiode – um circa anderthalb Grad Celsius zu kalt.“
Wie kommt es zu dieser typischen „Launenhaftigkeit“ im April?
Wie immer gibt es für natürliche Erscheinungen keinen bösen oder guten Willen, sondern schlicht und ergreifend naturwissenschaftliche Grundlagen. Dies gilt auch für den oft raschen Wechsel der Wetterlagen: zum Beispiel vom typischen Aprilschauer, der früher auch mal Schnee bis ins Flachland brachte, hin zu strahlendem Sonnenschein-Wetter. Die Sonne spielt dabei eine entscheidende Rolle, gibt Professor Fink zu bedenken. Denn die Sonnenstrahlung ist im April wegen ihres relativ hohen Einstrahlwinkels schon sehr intensiv. Man bedenke: Der jahreszeitliche Tiefststand der Sonne Ende Dezember ist Anfang April schon ein Vierteljahr her. Die starke „Kraft“ der Sonne im April führt somit auch zu einer schnellen Erwärmung der Erdoberfläche, sobald sich Wolken verziehen. Dies begünstigt die bekannte „Wechselhaftigkeit“ – anders als im Januar, wenn die Sonne sehr tief steht und wenig „Kraft“ hat.
Welchen Einfluss haben die Großwetterlagen?
Die Wetterexperten verweisen auf das häufige Auftreten von „Kaltlufttropfen“ in höheren Luftschichten. Diese brachten beispielsweise in der dritten Dekade in Höhenlagen noch einmal Schneefälle.
Es gab relativ häufig Kaltluftvorstöße aus dem Norden, und dadurch das klassische Aprilwetter mit Schauern. Ungestörte Hochdrucklagen, die in den Vorjahren oft das Geschehen bestimmten und für „Schönwetter“ sorgten, waren nicht zu verzeichnen. Sie sind für den April auch eher untypisch.
Anders als in den vergangenen Jahren, als es schon Ende März/Anfang April sogenannte Sommertage gab, waren diese im April nicht zu verzeichnen. Ein „Sommertag“ im Sinne der Wetterkundler ist ein Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur 25,0 °C erreicht oder überschreitet. Als Maximaltemperatur wurden an der Station in Ottenau am 22. April 24,4 °C gemessen.
War der April reich an Niederschlägen?
Gut 112 Liter pro Quadratmeter fielen an der Station Ottenau im April. Zusammen mit dem Niederschlag aus dem März (167 Liter pro Quadratmeter) sind das knapp 280 Liter in diesen Frühjahrsmonaten.
Im April 2022 fielen sogar 125,6 l/m2 in Ottenau. Aber 2021 gingen lediglich 48,4 Liter darnieder,
Der April im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 10,9 °C (11,2 °C), Niederschlag 112,4 l/m2 (125,6 l/m2), Niederschlagstage 15 (13).